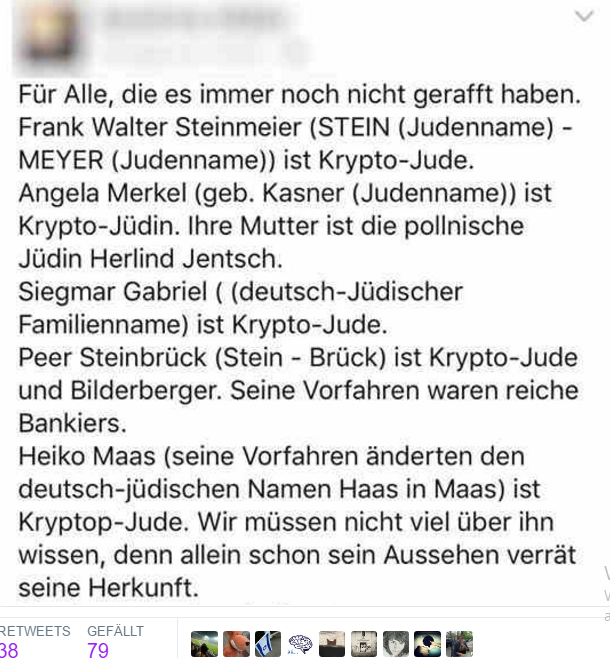|
Dieser Artikel wurde durch Feliks bei Wikipedia gelöscht (Siehe Vorgang Feliks bei Wikihausen).
Hier geht es zur Archive Version Jüdische Namen weisen etymologische Besonderheiten auf. Dieser Artikel beschränkt sich vorerst auf das aschkenasische Judentum. Die sephardischen, orientalischen, slawischen und neu-hebräischen Namen bleiben hier unberücksichtigt. Inhaltsverzeichnis Geschichte und PrinzipienAschkenasische Juden, also die ursprünglich im nördlichen Mittel- und Westeuropa angesiedelten und die von dort z. B. nach Osteuropa ausgewanderten Juden, hatten bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts meist noch keine festen Familiennamen, im Gegensatz zu den Sephardischen Juden (Sephardim) die schon seit der Frühzeit eigene Namen hatten. In der Regel waren die sephardischen Namen patronym und wurden seit dem 14. Jh. graezisiert wie: Nachmanides, Maimonides, Avramides, was bedeutet Nachkomme des Maimon, Nachman, Abraham. In aller Regel wurde der Name des Vaters als zweiter Name (Patronym) benutzt, also beispielsweise Jakob ben Nathan = Jakob, Sohn des Nathan. Grund dafür ist u. A. die Verordnung von Rabbenu Tam (Jacob ben Meir) aus dem 12. Jahrhundert, dass in einer Scheidungsurkunde nur von Juden unter Juden verwendete Namen (d. h. Eigen- und Vatersnamen) verwendet werden durften, aber nicht von Juden ausschließlich im Verkehr mit Nichtjuden verwendete Beinamen. Diese Anweisung wurde danach bei vergleichbaren Verträgen, z. B. Ehe- und Geschäftsverträgen, analog angewendet. Bis heute bestehen jüdische Namen aus dem Vornamen und dem Vornamen des Vaters, wobei ein ben („Sohn von“) bzw. bat („Tochter von“) dazwischengeschoben wird. Im religiösen Bereich wird der Name besonders zu rituellen Zwecken benutzt, so bei Jungen erstmals bei der Beschneidung sowie bei der Bar Mitzwa anlässlich des Aufrufs zur Toralesung. In der Regel steht dieser Name auch auf dem Grabstein eines Juden. Es gab aber viele Ausnahmen von dieser Regel. Am wichtigsten war wohl der Brauch, eine rabbinische Dynastie mit einem – meist vom Herkunftsort des Gründers abgeleiteten – Familiennamen zu bezeichnen, z. B. von Katzenelnbogen (damals in Hessen) oder Emden. Diese Nachnamen dienten teils als Familiennamen, teils sozusagen als Markennamen. Schwiegersöhne, die Rabbiner wurden, erbten oft den Namen, und Söhne, die nicht Rabbiner wurden, trugen ihn meistens nicht. Die Sippen- oder Stammnamen Kohen und Levi (mit vielen Varianten) wurden von Vater auf Sohn weitergetragen und erschienen in fast allen jüdischen Urkunden, Grabsteinen usw., wenn ein dort erwähnter Mann (oder der Vater oder Ehemann einer Frau) dem Stamm zugehörte. In manchen Orten, besonders wo es eine größere jüdische Gemeinde gab, wurden Nachnamen zwar nicht offiziell, aber doch einigermaßen regelmäßig verwendet. In Prag war dies besonders der Fall.[1] Die älteste nicht mehr erhaltene Synagoge Prags, die Altschul, war über mehrere Jahrhunderte der Hauptsitz der Altschul oder Altschuler Familien. Ein Nachkomme von Flüchtlingen aus der Provence hatte sich zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Prag niedergelassen.[2] In den absolutistisch regierten Staaten Mitteleuropas wurde Ende des 18. Jahrhunderts damit begonnen, jüdische Bewohner als Bedingung für erweiterte Bürgerrechte zur Annahme eines unveränderbaren Familiennamens zu zwingen. Zuerst geschah dies 1787 in den Habsburgischen Erbländern, es folgten weitere Staaten und Städte. In Preußen: 1790 Stadt Breslau, 1791 Regierungsbezirk Breslau, 1794 Regierungsbezirk Liegnitz bzw. Glogau, 1812 (als Teil der Emanzipation) Altmark, Neumark, Pommern, Westpreußen, Ostpreußen; 1833 Posen; 1845 Kulmerland; 1846–1848 restliche Provinzen. Im restlichen Deutschland: 1813 Bayern, 1828 Hannover und Württemberg, 1834 Sachsen. Noch bevor im Kaiserreich Frankreich durch Napoléons Erlass vom 20. Juli 1808 alle dortigen Juden zur Annahme von festen Nachnamen verpflichtet wurden, war dies durch Dekret vom 31. März 1808 bereits in dem von Napoléons Bruder Jérôme regierten Königreich Westphalen angeordnet worden. Nach und nach führten dann alle Staaten Europas ähnliche Regelungen ein. Die Juden konnten ihre neuen Namen nicht immer frei wählen; so kam es in vereinzelten Fällen zu erniedrigenden oder beleidigenden Nachnamen (Trinker, Bettelarm, Maulwurf), die allerdings später meist wieder geändert werden durften. Aber die österreichischen und französischen Gesetze ließen keine neuen Namen zu, die den jüdischen Hintergrund des Trägers deutlich herausstellten (z. B. Namen aus dem Alten Testament oder alttestamentliche Städtenamen). Die jüdischen sollten sich von deutschen Familiennamen möglichst nicht unterscheiden, um die Integration der Juden zu fördern, die in dieser Zeit zunächst meist beschränkte und später dann auch volle Bürgerrechte erhielten. Je nach Region konnte die Namensgebung unterschiedlich verlaufen, so dass bei der Deutung der Namen auch die Herkunftsregion eine große Rolle spielen kann. Nicht zu verkennen ist aber auch die durch die Namensanalyse vermutete Freude der Juden an Synonymen, am Denken um die Ecke, an Verballhornungen, an Wortspielereien und an (Selbst-)Ironie. Gerade ihre Mehrsprachigkeit und die Eigenart der hebräischen Schrift, nur Konsonanten abzubilden, trugen dazu wesentlich bei. Beispiele für die NamensbildungBiblische Vornamen
Die zwölf Stämme genießen in der jüdischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert und wurden daher gerne für die Namenswahl in direkter oder umschriebener Form herangezogen. Der Name Israel selbst ist ursprünglich selten und hat erst durch die deutschen Judenverfolgungen des 20. Jahrhunderts (Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen) Verbreitung gewonnen. Dabei wurde nicht selten auf die in 1. Mose 49,3–27 EU angesprochenen Symbole ausgewichen wie
oder auf den sie symbolisierenden Schmuck auf den Priestergewändern laut 2. Buch Mose 28,17–21 EU Ersatzweise auch die ihnen zugeordneten Fahnenfarben wie
häufig erweitert um Zusätze, etwa Grünspan, Bleiweiß, Weisrock, Rosenblatt, Rosenzweig, Rosenthal. Vergleichbar sind Silber und Gold beinhaltende Namen, die mit den Erzengeln Michael und Gabriel in Verbindung gebracht werden; denn Gabriel brachte nach der Überlieferung das Gold zur Erde, daher Früchte des Heiligen Landesnach 5. Buch Mose 8,8
Eindeutschungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Allgemeine Berufsbezeichnungen
Landesübliche Namen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die charakteristischen Namen der jeweiligen Umgebung wurden nicht selten ebenfalls übernommen, um das Stigma der damaligen Zeit, Jude zu sein, zu verbergen. Vor allem beim Wechsel des Glaubens wurden stigmatisierende Namen abgelegt und landesübliche Namen angenommen. Darunter verstehen sich Herkunftsnamen, Eigenschaftsnamen (Kurz, Krause, Klein, Lang) ebenso wie Berufsnamen (Schmidt, Müller) Verschleifungen / Verballhornungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einige eindeutig erscheinende Namen sind Verfälschungen von Kosenamen oder Kurznamen in ähnlich klingende deutsche Wörter, die aber mit dem Ursprungswort nichts gemein haben. (Belege siehe Quellenverzeichnis unten)
Literatur
0 Kommentare
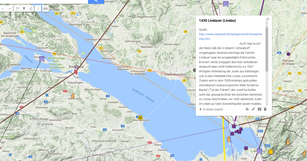 Grundlage der '''Jüdischen Namenskodierung''' ist, dass es für das historische Judentum sehr wichtig ist, die jüdische Stammlinie zu pflegen. Einer der Grund dieser Pflege der Stammlinie ist, dass z. B. der jüdische Messias noch nicht erschienen ist. Laut der Bibel muss der Messias dem Stamm Juda angehören (Genesis 49,10) und ein direkter männlicher Nachkomme (Sohn nach Sohn) von König David (1. Chronik 17,11, Psalm 89,29-38; Jeremia 33,17; 2. Samuel 7,12-16) und König Salomon sein. (1. Chronik 22,10; 2. Chronik 7,18). Aufgrund der Tatsache, dass das Christum behauptet, dass Jesus der Messias ist, entbrannt in der Antike ein theologischer Diskurs, ob Jesus ein Nachfahre von David und Salomon sei. Des Weiteren erlaubt die Pflege der jüdischen Stammlinie, wie beim Deutschen Adel, die Bedeutung der Familie zu betonen. Neben dem Judentum wissen z. B. auch noch viele Syrer, welcher biblischen Stammlinie sie entstammen. == Grundlage == Grundlage der jüdischen Namenskodierung sind die Zwölf Stämme Israels. Die jüdische Namenskodierung über Familiennamen war die Folge, dass im 18. Jahrhunderts damit begonnen würde, jüdische Bewohner, als Bedingung für erweiterte Bürgerrechte, zur Annahme eines unveränderbaren Familiennamens zu zwingen. Im Gegensatz zum hergebrachten jüdischen Stammlinienkodierungsystem, bei dem über die Rabbilinie, die Stammlinie gepflegt wurde, bedeutete die Annahme eines unveränderbaren Familiennamens, dass die jüdische Stammlinie nur noch durch aschkenasische Synonyme, ortsbezogen Familiennamen, Namenszusätze, Namenskombinationen oder der Abwandlung des Familiennamen gepflegt werden konnte (siehe Stammlinie der Askanier (Adelsgeschlecht)) Kodierung über die Zwölf Stämme Israels Zur Pflege der Stammlinie erfolgte die Namenskodierung vielmals über Synonyme für den Stamm. Die bekanntesten aschkenasische Synonyme für einem der Zwölf Stämme Israels sind die folgenden.
P.S. In der Literatur wird erwähnt, dass der Löwe ein Symbol für den Stamm Juda sei. Des Weiteren soll auch die Stammlinie Synonyme für die Stammlinie Josef / Ephraim das Symbol auch mit Schwarz kodiert worden sein. Somit ist Vorsicht geboten bei der Zuordnung des jüdischen Stammes. Kodierung über biblische Namen Eine weitere Pflege der jüdischen Stammlinie erfolgte gleichfalls über aschkenasische Synonyme für biblische Persönlichkeiten.
Kodierung über Orte Des Weiteren erfolgte die Namenskodierung auch über Orte, wie z. B. eine Stadt. Der Vorteil dieser Namenskodierung war, dass die Stammlinie geografisch gut verankert werden konnte.
Diese jüdische Namenskodierung war auch üblich in Spanien sowie Portugal. Unter den iberischen Juden sind viele Familiennamen gleichfalls ortsbezogen. Die jüdischen Familiennamen wie Espinosa, Gerondi, Cavalleria, De La Torre, del Monte, Lousada und Villa Real sind alle ortsbezogen. Dieses gilt auch für den jüdischen Namen Sasportas. Im balearischen Dialekt heißt La Porta Sasportas. Zudem kann der jüdische Familienname Asturias der Art abgleitet werden, dass diese sich auf eine jüdische Familie bezieht, die in die nördliche Provinz Asturien]von Spanien migriert sind. Kodierung bei einer geografische Trennung der Stammlinie Eine weitere mögliche Kodierung der Stammlinie, z. B. bei einer geografischen Trennung der Stammlinie, erlaubte eine Kombination des Stammnamens mit dem neuen Wohnort. Ein Beispiel hierfür ist z. B. der jüdische Familienname "Cleveland Lindauer". Bekannt ist auch, dass sich die oberschlesischen Juden nach dem Ort, in dem Sie wohnten, sich umbenannten. Zudem die Möglichkeit der Kodierung der jüdischen Stammlinie über die männlichen sowie weiblichen jüdischen Vornamen. Zum Beispiel verweist der Namen ''Cyrla Lindau(er)'', die 1917 in Łódź geboren wurde, auf dem Ort Cyrla (Pasmo Jaworzyny) im südlichen Polen. Dieses ist auch der Fall bei ''Laurent Lindauer'' (c1720, Pays de Bitche, Lothringen). Laurent ist ein Synonyme für den Vorort des Ostias Laurent''(um). Dieses ist auch der Fall beim weiblichen Vornamen Myra. Der Name Myra bezieht sich die antike Stadt Lykien bei Antalya in der Türkei. Myra war schon in der klassischen Epoche von einiger Bedeutung und ab der Zeit des Hellenismus eine der sechs größten Städte des Lykischen Bundes. Auch der Name Sidonia Lindauer verweist auf die Stadt Sidon im Libanon. Kodierung mit Persönlichkeiten Des Weiteren wurde auch der Familiennamens auch mit einer Persönlichkeit kombiniert. Beispiele hierfür sind die Namenskombinationen ''Meinrad Lindauer'' (Tell City, Indiana) und ''Lindauer von Boetticher'' (Lettland). Leider erlaubt diese Namenskodierung nicht, die jüdische Stammlinie örtlich zu verankern. Kodierung der Stammlinie Manasse Außerdem wurde der Familienname vielfach mit dem Namen des jüdischen Stammes kombiniert. Dieses geschah bei der jüdischen Familie Lindauer mehrmals. Namentlich bekannt Lindauer mit dem Beinamen des Stammes Manasse sind:
Abwandlung des Familiennamens Zur Weiteren Differenzierung der jüdischen Stammlinie erfolgte zu dem eine stetige Abwandlung des Familiennamens. Im ersten Schritt, wenn möglich, würde der jüdische Familienname mit einem Umlaut, wie z. B. ö, ä, ü, ï, n̈, ë oder ÿ geschrieben. Zum Beispiel wurde der jüdische Name ''Lindeyer'' in Baden-Württemberg ohne Umlaut geschrieben, aber in den Niederlanden mit Umlaut ÿ. Ein weiteres Beispiel der Transformation eines jüdischen Familiennamens ist die Transformation des Familiennamens ''Lindauers'' zu ''Lindaur'', ''Lindau'', ''Lindäer'', ''Lindaor'', ''Lindaner'' bzw. ''Lindaer''. Kodierung über den Vornamen Eine Differenzierung der Stammlinie erfolgte auch über jüdische Vornamen. Diese Kodierung erlaubte es durch den Vornamen gleichfalls auf die Stammlinie zu schließen. Aber es zeigt sich, dass viele bei den kryptojüdischen Stämmen der Familie Lindauer zwar biblische Vornamen verwendet wurden, aber diese können genauso gut christlich sein. Ein Grund wird gewesen sein, dass ein zu jüdischer Vorname offenbart hätte, dass die Familie ihr Judentum kryptojüdisch lebt. Eine umfassende Liste von jüdischen Vornamen kann verschieden Interenetseiten entnommen werden. Rekonstruktion der jüdischen Stammlinie Das jüdische Kordierungsystem erlaubt es, über die verwendeten Namen, abzuleiten, zu welchem Stamm sowie zu welcher Stammlinie die jüdische Familie gehört. Dieses erlaubt es, bei einem ausreichenden Datensatz sehr gut die Stammlinie einer jüdischen Familie über mehre Jahrhundert zu rekonstruieren. Besonders leicht ist die Rekonstruktion der Stammlinie, falls eines der aschkenasische Synonyme für einen der Zwölf Stämme Israels verwendet wird. Zum Beispiel kann gesagt werden, dass die Rothschilds laut dem biblischen Stammbaum Nachfahren des ersten Sohnes von Jakob, Ruben, sind. Es zeigt aber zum Beispiel die Bewertung der Stammlinie der Manasse, dass die biblische Stammlinie von Jakob mit hoher Wahrscheinlichkeit theologisch konstruiert wurde. Der Grund hierfür ist, dass angeblich eines der Söhne von Jakob der Stammvater des Stammes Manasse sein soll. Einer der Gründe warum diese nicht stimmen kann, ist das z. B. in Ostindien jüdische Manasse, die jüdische Stammlinie Bnei Menashe, leben. Bitte verzeihen Sie. Ich hatte diesen Artikel bei Wikipedia eingestellt. Dieser Artikel wurde nach ca. 12 Stunden ohne sachliche Begründung gelöscht. Sollte Sie Jude sein und mir herleiten können, dass meine These der Kodierung nicht richtig ist, so würde dieses natürlich aufgreifen und meine These verwerfen. Wie gesagt, viele Deutsche werden jüdische Vorfahren haben. Alleine diese Twitterliste zeigt wie viele Deutsche jüdische Namen haben.
Von 1748 bis 1868 ließen sich in Wien etwa 3300 Juden taufen. Die Hälfte von Ihnen waren Findelkinder, die zur Aufnahme ins Findelhaus getauft wurden. Mit der Taufe wurde auch der jüdische Familienname geändert. Erst nach der gänzlichen Erlangung der Bürgerrechte, im Jahre 1867, beendete auch die Stadt Wien die Judentaufe. Interessant ist aber der Aspekt, dass der Name des getauften Juden immer geändert wurde.
"Im 18. Jahrhundert war in Wien eine Judentaufe in einer Pfarre ein großes, auch gesellschaftliches Ereignis. Oft erfolgte sie in Verbindung mit einem feierlichen Hochamt, zuweilen auch unter der persönlichen Anwesenheit des Erzbischofs, unter den Taufpaten befanden sich Grafen, Fürsten und Angehörige der kaiserlichen Familie. In dieser und späterer Zeit war es üblich, auf mehrere christliche Vornamen, zumeist jenen der Taufpaten, getauft zu werden. Drei, vier oder gar fünf Taufnamen waren auch später keine Seltenheit. In späterer Zeit, nach 1868, behielt man oft seinen jüdischen Vornamen, man wurde nur auf diesen getauft, nahm keinen weiteren Vornamen an, was wohl praktische Gründe gehabt haben mag und u.a. oft eine Änderung der Dokumente erübrigte." Quelle: Konvertitennamen: Der Namenswechsel jüdischer Konvertiten in Wien von 1748 bis 1868, textliche Übernahme Somit zeigt die Publikationen von Anna Staudacher aus Wien, wie die jüdischen Namen abgewandelt wurden. Interessant ist dieses, weil die Familie Lindauer aus Jebenhausen sich im Jahre 1777 ein jüdisches Stammbaumzertifikat ausstellen ließen. Vor dieser Zeit erfolgte die Pflege der Stammlinie nicht mehr über die Rabbilinie. In Ihren Artikel listet Anna Staudacher mehre Namen auf, die gleichfalls einen Ortsbezug haben werden. Diese sind:
|
AutorRobert Brockmann Archiv |